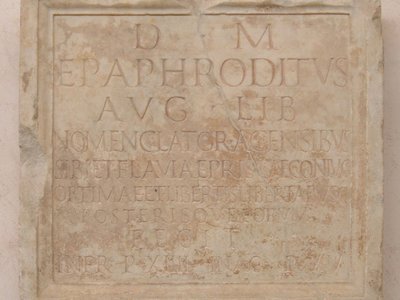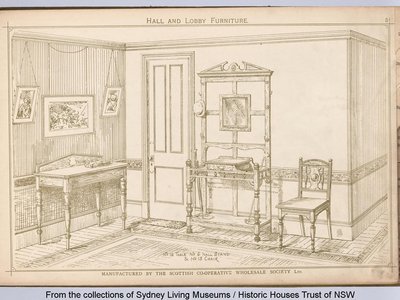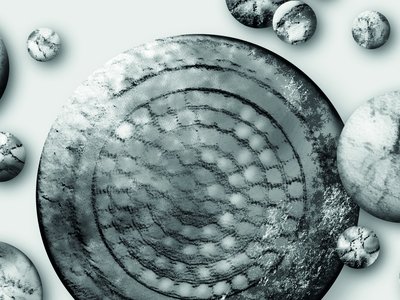Projektbereich Ordnungen
Eigentumsordnungen und alternative soziale Ordnungsprinzipien
Das Öffentliche, das Private, das Gemeinschaftliche

Mit den Fragen, welche Objekte die Form des Eigentums herausfordern und wie Beziehungen und Konflikte zwischen Eigentumssubjekten geregelt werden, stehen auch Eigentumsordnungen zur Debatte. Noch grundsätzlicher sind sie mit Blick darauf zu diskutieren und zu analysieren, welche Rolle das Eigentum jeweils in einem sozialen Regelgefüges spielt und wie es mit anderen Prinzipien koordiniert ist. Während das moderne Privateigentum als Basisinstitution mit weiteren tragenden Institutionen wie individuellen Grundrechten, der bürgerlichen Kleinfamilie, der repräsentativen Demokratie oder dem Wohlfahrtsstaat zusammengreift, ergeben sich in diesem institutionellen Gefüge auch wiederholt Spannungen, die vielfältiger und komplexer werden, wenn neue Bereiche propertisiert werden oder sich das Spektrum der Ordnungsansprüche erweitert: Ist die Verfügung über Daten und Körpersubstanzen eine Frage ökonomischer Freiheit und Verfügungsgewalt oder der Persönlichkeitsrechte? Sind öffentliche Infrastrukturen vorrangig unternehmerisch verantwortlich zu bewirtschaften oder um jeden Preis gesellschaftlichen Bedürfnislagen anzupassen? Regieren in Paarbeziehungen kodifizierte Eigentumsrechte oder Traditionen und Aushandlungen der gemeinsamen Lebensführung die Weise, in der man Besitzgüter gebraucht und weitergibt? Und wie strukturiert Eigentum die fundamentalen Formen der Weltbeziehungen, die zugleich etwa auch durch religiöse oder traditionelle Ordnungen bestimmt sind? Die Verschränkung, Konkurrenz und mögliche Kollision verschiedener sozialer Ordnungsprinzipien macht nicht nur die Regulierung, sondern auch die Analyse solcher Kontexte zu einer schwierigen und lohnenden Aufgabe. Sie betrifft erstens die krisenhafte Koordination von Basisinstitutionen, zweitens Bereichskonflikte zwischen Eigentum und konkurrierenden Ordnungsprinzipien sowie drittens Auseinandersetzungen darum, ob Eigentum insgesamt gegenüber anderen sozialen Zwecken priorisiert oder ihnen untergeordnet wird. Da Institutionen schließlich auch die Weltbeziehungen und Selbstverhältnisse der Beteiligten formieren, gilt es im Spannungsfeld proprietärer und nichtproprietärer Ordnungen zudem auch Subjektivierungsprozesse und -programme zu untersuchen. Die Projekte des Bereichs „Ordnungen“ gehen diesen Fragen auf unterschiedlichen Ebenen sozialer Ordnung nach.