Forschungsprogramm
Der SFB/TRR 294 untersucht die gesellschaftlich grundlegende Institution des Eigentums mit Blick auf ihre prinzipielle Wandlungsfähigkeit, den Wandel, den sie gegenwärtig erfährt sowie die Folgewirkungen dieser Dynamiken. Die Ausgangsbeobachtung, dass namentlich das Privateigentum einerseits global an Bedeutung gewonnen hat, andererseits aber durch eine Vielzahl von Entwicklungen und Widerständen herausgefordert wird, ist in der ersten Förderphase in Untersuchungen zur geschichtlichen Genese heutiger Eigentumsordnungen, zu aktuellen Konflikten und alternativen Ordnungsoptionen empirisch und konzeptuell erhärtet und konkretisiert worden.
In der zweiten Förderphase sollen die identifizierten Veränderungsprozesse nun systematisch vergleichend erforscht und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Vergleichsgesichtspunkte sind dabei die extensionale Verbreitung, Ausweitung oder Kontraktion etablierter Eigentumsmuster (etwa im Bereich geistigen Eigentums), die intensionale Bestimmung von Eigentum (die sich etwa für Eigentum an Natur zu wandeln beginnt), die zeitliche Dauer von Wandlungsprozessen und die Temporalität von Eigentum selbst (vom Familienerbe bis zum Hochfrequenzhandel) sowie die räumliche Verteilung und Veränderung von Eigentumsgütern und -ordnungen (besonders im Vergleich verschiedener Weltregionen). Auch die Projektbereiche, in denen die Zusammenarbeit organisiert ist, sind nun auf vergleichende Analysen hin orientiert und geordnet.
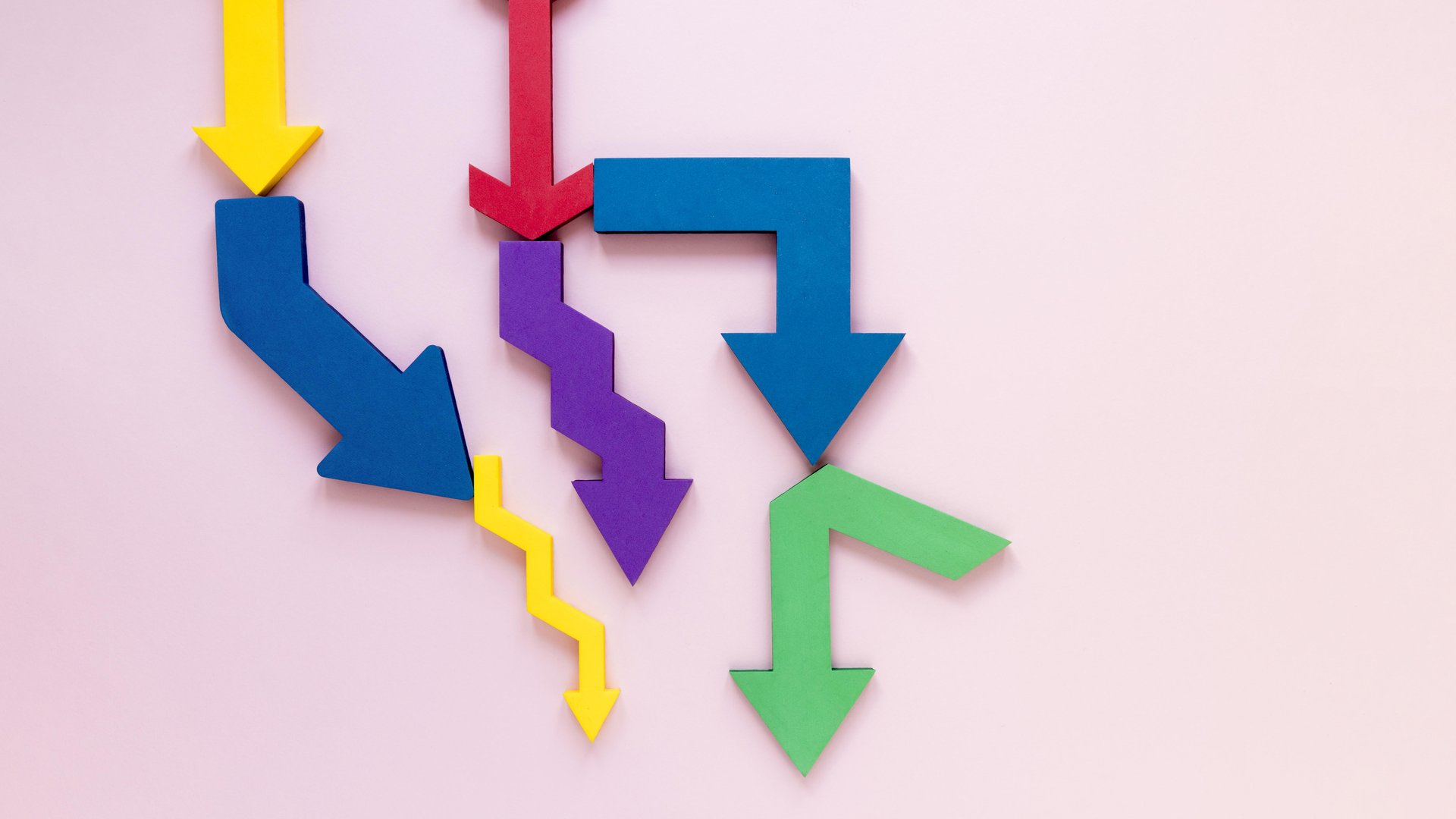

Wir wollen erstens problematische Eigentumsobjekte (von Daten, Natur und Wasser bis hin zu Windkraft und Universitäten) erforschen, zweitens Spannungen zwischen Eigentumssubjekten von natürlichen Personen über rechtliche Personen bis hin zu nicht-personalen Entitäten untersuchen und drittens detailliert beleuchten, wie und an welchen Stellen Eigentumsordnungen mit anderen gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien koordiniert sind oder konkurrieren. Im Hintergrund stehen dabei Forschungsannahmen, die die Hypothesen des Einrichtungsantrags in differenzierter und präzisierter Form fortführen. Statt einen einfachen Gegensatz zwischen Entbettung und Wieder-Einbettung oder Infragestellung des Eigentums anzunehmen, gehen wir inzwischen davon aus, dass die globale Expansion des Eigentums teilweise seine Diversifizierung erfordert, teilweise Abwehr auslöst und dass es teilweise auch (temporär oder dauerhaft) anderen gesellschaftlichen Prinzipien untergeordnet wird, wobei nicht zuletzt aufgrund der fortbestehenden Heterogenität von Eigentumsordnungen kein einheitlicher Veränderungsprozess anzunehmen ist. Um die Vielfalt dieser Themen und die vielgestaltige Praxis von Eigentum empirisch vergleichend zu erforschen, konzeptuell zu integrieren und sozialtheoretisch zu deuten, ist auch weiterhin die Zusammenarbeit verschiedener geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer unerlässlich.
Über diese strukturellen Erwägungen hinaus prägen konkrete Zwischenergebnisse unserer Forschung das Programm für die zweite Förderphase. (Zentrale Befunde aus der ersten Förderphase sind im Working Paper No. 9 „Radikalisierung und Dekomposition von Privateigentum“ zusammengefasst.) So haben wir nicht nur in den Sozialwissenschaften, sondern auch in der gesellschaftlichen Praxis Anzeichen von Eigentumsvergessenheit entdeckt und wollen entsprechend weiter erforschen, wie Eigentum unsichtbar (gemacht) oder sichtbar wird; wir werden den vielfältig behaupteten Trend zu einer Rückkehr des Staates anhand staatlicher Eigentumsanteile und Regulierungen auf verschiedenen Ebenen untersuchen und haben eine Perspektive auf Ungleichheit erarbeitet, die neben der ungleichen Verteilung von Einkommen und Vermögen auch die sozialen Machtdifferenzen zu analysieren erlaubt, welche mit der Verfügung über Eigentum einhergehen.
Weiterhin sind wir durch unsere ersten Ergebnisse in der Lage, die komplexe innere Komposition von Eigentum präziser zu untersuchen: Wir werden der Hypothese nachgehen, dass sich Eigentum gerade bei hoher Konzentration zunehmend vom Besitz abkoppelt, und analysieren, wie in komplexen Eigentumsketten nicht nur verschiedene Güter, sondern auch verschiedene Verfügungsrechte, proprietäre und nicht proprietäre Elemente verbunden sind. Im Licht dieser Möglichkeiten können wir auch gezielt fragen, ob alternative Eigentumsformen von Commons bis zu Teilungsarrangements die kapitalistische Ordnung eher konfrontativ infrage stellen oder sie komplementär ergänzen. In neu eingerichteten Theorie- und Themenforen nehmen wir die Ergebnisse der ersten Förderphase gezielt auf und verbinden sie mit Debatten um Staatlichkeit im Wandel, Eigentum an Infrastrukturen, Kommodifizierung und Assetisierung, Eigentum in der sozialökologischen Krise und die Persistenz nicht-westlicher Eigentumsordnungen. Durch diese Schwerpunktsetzungen kann der SFB zugleich die veränderten (informations-)technologischen, ökologischen und weltpolitischen Rahmenbedingungen erfassen, die die Institution des Eigentums unter Veränderungsdruck setzen.
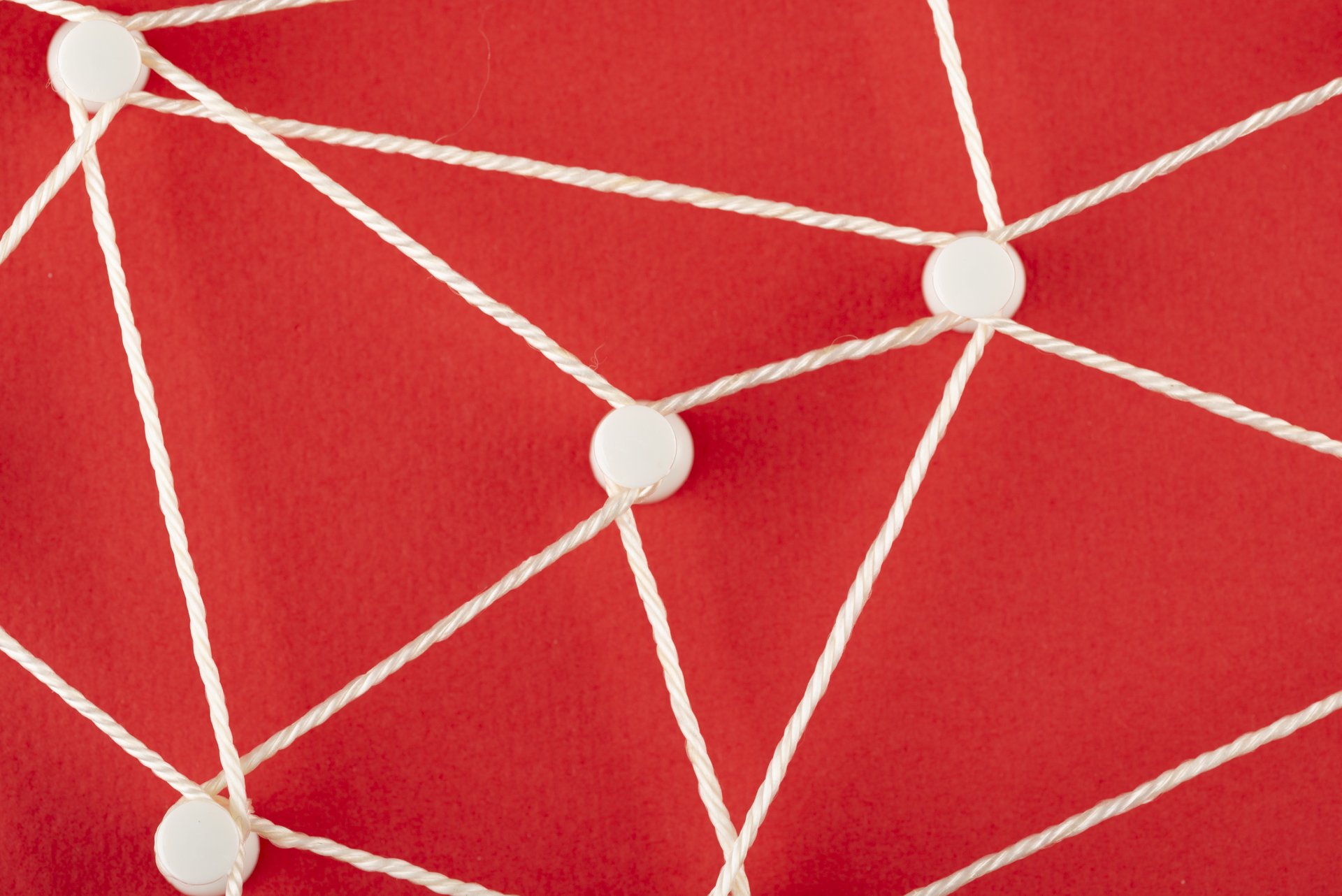
Insgesamt verspricht die vergleichende Forschung in der zweiten Förderphase damit die Vielfalt von Wandlungsprozessen, die Eigentum von alltäglichen Nutzungspraktiken bis zu den Rechtsformen und Geschäftsstrategien großer Unternehmen, von der kommerziellen Erschließung immer weiterer Teile der Welt bis zur politischen Begrenzung von Eigentumsansprüchen neu formieren, systematisch zu erfassen und einzuordnen. In der projektübergreifenden Forschung und Diskussion wird zudem zu klären sein, ob sich diese Prozesse auf einen Kern entscheidender Ursachen und Bedingungen zurückführen lassen und ob sie sich zu einer veränderten Grundstruktur der geregelten Verfügung über Güter verbinden.
Publikationen aus dem SFB
Ein wesentlicher Bestandteil des Erkenntnistransfers ist die SFB-eigene Buchreihe "Strukturwandel des Eigentums". Die Reihe wird von den Sprecher:innen Silke van Dyk, Tilman Reitz und Hartmut Rosa herausgegeben und erscheint Open Access im Campus Verlag.
Hier finden Sie die bereits erschienenen und in Kürze erscheinende Bände.
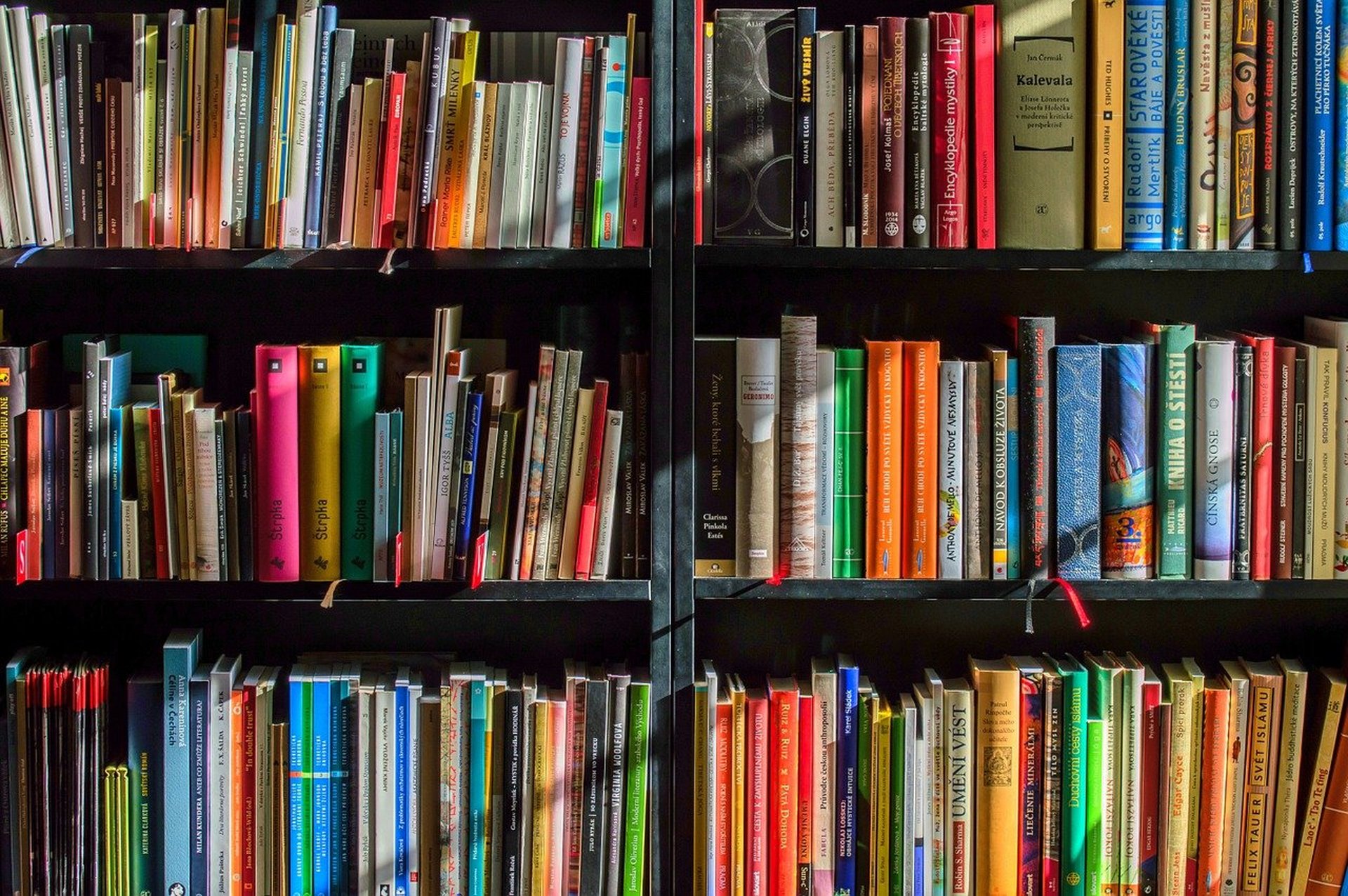
Neue Bibliothek des Eigentums
Die Onlineplattform Neue Bibliothek des Eigentums ist eine weitere Säule des Erkenntnistransfers und der Öffentlichkeitsarbeit des SFB, die Open Access zugänglich ist.
Die Neue Bibliothek des Eigentums (NBE) bietet für eine breite, auch außer-universitäre Nutzer:innenschaft (z.B. NGOs, interessierte Öffentlichkeit, Pressevertreter:innen) zwei Hauptfunktionen an: erstens, eine umfangreiche, durchsuchbare Datenbank mit einschlägigen Primär- und Sekundärtexten zum Thema Eigentum und den Publikationen des SFB, sowie zweitens eine öffentliche Plattform, auf der die Forschungsergebnisse der SFB-Projekte zu-gänglich gemacht werden. Um der interessierten Öffentlichkeit zentrale Fragen- und Problemstellungen der Eigentumsforschung näher zu bringen, wurde eine umfangreiche, interdisziplinäre und epochenübergreifende Bibliographie erstellt. Ein Herzstück der Datenbank sind die einführenden Fachkommentare von SFB-Mitgliedern, die die ausge-wählten Quellen kontextualisieren und gerade anspruchsvolle, ältere klassische Texte für eine breitere Leserschaft aufbereiten. Im Aufbau befindet sich ein neues Format der NBE: Um gezielter in gesellschaftliche Debatten intervenieren zu können, werden regelmäßig thematisch einschlägige Dossiers zur Verfügung gestellt, die sowohl einschlägige Formate aus dem SFB (Blog-Posts, Podcast-Folgen etc.) sowie wissenschaftliche, zivilgesellschaftliche und mediale Quellen umfassen und übersichtlich aufbereiten.
